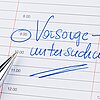Krankenhausfinanzierung
Die Finanzierung der Krankenhäuser teilen sich seit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz von 1972 die Bundesländer und die gesetzlichen Krankenkassen.
Man spricht von der dualen Finanzierung. Demnach sollen
- Investitionskosten, wie z. B. Neubauten oder neue Geräte durch die Bundesländer finanziert,
- Betriebskosten, also alle Kosten, die für die Behandlung von Patientinnen und Patienten entstehen, von den Krankenkassen bezahlt werden.
Wo also ein Krankenhaus gebaut, erweitert oder geschlossen wird, entscheiden demnach die Länder und finanzieren diese Investitionsmaßnahmen. Auch für die Sicherstellung einer flächendeckenden stationären Versorgung sind die Länder zuständig. Wenn Krankenhausschließungen oder -insolvenzen zu Lücken in der stationären Versorgung führen, ist es also Aufgabe der Länder, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Die Behandlungskosten hingegen sind Sache der Krankenkassen. Seit dem Jahr 2020 werden diese über eine Kombination von Fallpauschalen und einer Pflegepersonalkostenvergütung (Pflegebudget) finanziert. Die Preise von Krankenhausleistungen, d.h. wie viel die Krankenkassen für eine stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten in Deutschland ausgeben, verhandeln die Kassen jedes Jahr auf Landesebene mit den Krankenhausgesellschaften (Landesbasisfallwert). In den Verhandlungen zum Landesbasisfallwert werden u.a. allgemeine Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachkosten berücksichtigt.
Die Ausgaben für „Krankenhausbehandlung insgesamt“ sind regelmäßig der größte Posten in der gesetzlichen Krankenversicherung. Fast jeder dritte Euro fließt in die Kliniken. Im Jahr 2023 erhielten die Kliniken aus der GKV 94,0 Milliarden Euro.
Investitionskostenfinanzierung durch die Länder
Gesetzlich sind die Länder dazu verpflichtet, die Investitionskosten ihrer Krankenhäuser zu finanzieren. Jedoch gehen die Investitionen der Bundesländer in die Krankenhausfinanzierung seit Jahren zurück. So sank die Investitionsquote der Länder von 25 Prozent im Jahr 1972 auf nur noch ca. 3 Prozent im Jahr 2021.
Die Höhe der Investitionen unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland stark – je nach Einwohnerzahl und Liquidität der öffentlichen Kassen. Zahlten die Länder 1993 noch 3,9 Milliarden Euro, waren es 2021 noch 3,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig stiegen dafür die Krankenhausausgaben der Krankenkassen von 29 Milliarden Euro auf 85,9 Milliarden Euro.
Klimaschutzmaßnahmen
Auch notwendige Investitionen in klimaschützende Maßnahmen fallen in die Finanzierungsverpflichtung der Länder.
Einige Bundesländer haben dazu bereits Förderprogramme aufgelegt. Auch auf Bundesebene gibt es entsprechende Förderprogramme. Für die Durchführung klimaschützender Maßnahmen der Krankenhäuser gelten die einschlägigen gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben.
Um auch das Personal für energetische und ressourcenschonende Maßnahmen zu sensibilisieren, hat der Bund zusätzlich ein Förderprojekt angestoßen.
Betriebskostenfinanzierung durch die Kassen
Wenn Krankenhäuser im Rahmen der Krankenhausplanung der Bundesländer in den Landeskrankenhausplan aufgenommen werden, dann sind die Krankenkassen zur Erstattung der Behandlungskosten in diesen Krankenhäusern verpflichtet. Die Vergütung erfolgt für somatische Behandlungen über das DRG-System nach § 17b Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG).
Kern des DRG-Fallpauschalensystems ist der Fallpauschalenkatalog. Er enthält über 1.200 abrechenbare Fallpauschalen, die das komplexe Behandlungsgeschehen abbilden. Der Basispreis für die einzelnen DRG-Leistungen wird seit 2005 durch die Landesbasisfallwerte festgelegt. Sie werden jährlich von den Krankenhausgesellschaften und Krankenkassen auf Landesebene ausgehandelt.
Seit 2020 werden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung nicht mehr über die Fallpauschalen vergütet. Stattdessen erhalten die Krankenhäuser ein kostendeckendes Pflegebudget.
Für die Bereiche der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik gilt seit Inkrafttreten des Psych-Entgeltgesetzes (PsychEntgG) ein eigenes Abrechnungssystem (PEPP-System).
Grundsätzlich konnte mit den bisherigen DRG-Katalogen von Jahr zu Jahr eine bessere Differenzierung der DRG zwischen einfachen und teuren Leistungen erzielt werden. Damit wurde auch eine bessere und sachgerechtere Vergütung der Hochleistungsmedizin erreicht. Die DRG-Einführung hat also zunächst zu einer Verbesserung der Transparenz und Wirtschaftlichkeit der allgemeinen Krankenhausversorgung geführt. Die allgemeinen Krankenhäuser haben insbesondere ihre Prozessorganisation verbessert und Wirtschaftlichkeitsreserven realisiert; Fusionen und Kooperationen haben zugenommen. Die durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern hat sich von 14 Tage in 1991 auf 9,7 Tage in 2000 und zuletzt im Jahr 2023 auf 7,2 Tage verringert.
Jedoch kann das System auch Fehlanreize induzieren. Die Erlöse einer Klinik werden generiert durch die Fälle, die sie behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass es damit auch Eingriffe gibt, die medizinisch gar nicht nötig oder möglicherweise auch ambulant erbringbar sind. Aus ökonomischem Druck eine steigende Zahl von Fällen zu behandeln, frustriert Arztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte und dient auch den Patientinnen und Patienten nicht. Die in der letzten Legislaturperiode beschlossene Krankenhausreform soll hier ansetzen und Fehlanreize mindern. Ein zentraler Bestandteil der Reform ist daher die geplante Einführung einer Vorhaltevergütung - damit soll die Vorhaltung von bedarfsnotwendigen Krankenhäusern künftig weitgehend unabhängig von der Leistungserbringung zu einem relevanten Anteil gesichert werden.
Bundeshilfen seit 2020
Corona
In der Corona-Pandemie sind Krankenhäuser massiv unterstützt worden: von März 2020 bis Juni 2022 erhielten sie Versorgungsaufschläge und/oder Ausgleichszahlungen in Höhe von insgesamt rund 21,5 Milliarden Euro.
Hilfspaket Pädiatrie und Geburtshilfe
Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wurden weitere Vorschläge für Unterstützungsmaßnahmen der Krankenhäuser umgesetzt. So erhielten Krankenhäuser finanzielle Mittel in Höhe von jeweils 300 Millionen Euro in 2023 und 2024 für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Auch für die geburtshilfliche Versorgung werden zusätzliche Mittel in Höhe von jeweils 120 Mio. Euro für die Jahre 2023 und 2024 zur Verfügung gestellt. Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz wurde die finanzielle Förderung für beide Versorgungsbereiche bis 2026 verlängert.
- Förderung der Krankenhäuser mit Fachabteilungen für Geburtshilfe. Dafür werden den Bundesländern nach dem Königsteiner Schlüssel für die Jahre 2023, 2024, 2025 und 2026 jeweils 120 Mio. Euro zugewiesen, um Geburtshilfestandorte nach bestimmten Kriterien zu fördern (Vorhaltung einer Fachabteilung für Pädiatrie, Vorhaltung einer Fachabteilung für Neonatologie, Anteil vaginaler Geburten, Geburtenanzahl und Möglichkeit zur Durchführung von Praxiseinsätzen im Rahmen des berufspraktischen Teils des Hebammenstudiums). Ziel ist, eine bedarfsnotwendige flächendeckende Versorgung mit Standorten zur geburtshilflichen Versorgung auch im ländlichen Raum aufrecht zu erhalten.
- Förderung von pädiatrischen Leistungen. Für die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen wurde für die Jahre 2023 und 2024 das vor der Pandemie im Jahr 2019 erbrachte Erlösvolumen weitgehend unabhängig von den tatsächlich erbrachten Leistungen garantiert. Das Erlösvolumen von 2019 wird zudem bis in die Gegenwart fortgeschrieben und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils zusätzlich um 300 Mio. Euro aufgestockt. In den Jahren 2025 und 2026 werden zusätzliche Mittel (jeweils 300 Mio. Euro) über einen Zuschlag für die Behandlung pädiatrischer Fälle ausgezahlt.
Entlastungspaket Energiehilfen
- Die Energie- und Strompreisbremse hat für die Krankenhäuser zu umfangreichen Entlastungen geführt.
- Zudem wurde für Krankenhäuser im Zeitraum Oktober 2022 bis April 2024 ein Betrag in Höhe von 6 Milliarden Euro durch den Bund zur Verfügung gestellt, von dem die Krankenhäuser insgesamt ca. 5,1 Milliarden Euro in Anspruch genommen haben (davon ca. 1 Milliarde sogenannte direkte Kostenerstattungen und ca. 4 Milliarden Euro sogenannte indirekte Kostenerstattungen, also Pauschalzahlungen, sowie ca. 8 Millionen Euro Erstattung der Energieberatungskosten). Die Mittel wurden in die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds eingestellt und vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) an die Länder zur Weiterleitung an die zugelassenen Krankenhäuser ausgezahlt.
Zu beachten ist dabei: Die Mittel des Hilfsfonds waren zu keinem Zeitpunkt zum Ausgleich „allgemeiner inflationsbedingter Kostensteigerungen“ vorgesehen.
Rechtliche Basis
Einzelheiten der Vergütung der DRG-Krankenhäuser werden im Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), im Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) und insbesondere in der Fallpauschalenvereinbarung der Selbstverwaltungspartner geregelt.
Die Grundlagen für die Vergütung voll- und teilstationärer Leistungen von psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäusern und Fachabteilungen (Psych-Einrichtungen) sind im KHG, in der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) und in der von den Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene zu treffenden Vereinbarung über die pauschalierenden Entgelte für die Psychiatrie und Psychosomatik (PEPPV) niedergelegt.
Weitere Informationen
-
Krankenhausreform
Mit der Krankenhausreform werden folgende zentrale Ziele verfolgt: Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität, Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für Patientinnen und Patienten, Steigerung der Effizienz in der Krankenhausversorgung sowie Entbürokratisierung.
-
Fallpauschalen
Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Finanzierung der voll- und teilstationären Leistungen der deutschen Krankenhäuser über das sogenannte DRG-Fallpauschalensystem.
-
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
Gesetzestext des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze auf www.gesetze-im-internet.de
-
Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (KHEntgG)
Der Gesetzestext zum KHEntgG auf www.gesetze-im-internet.de
-
Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze
Die Bundespflegesatzverordnung – BPflV im Wortlaut auf www.gesetze-im-internet.de